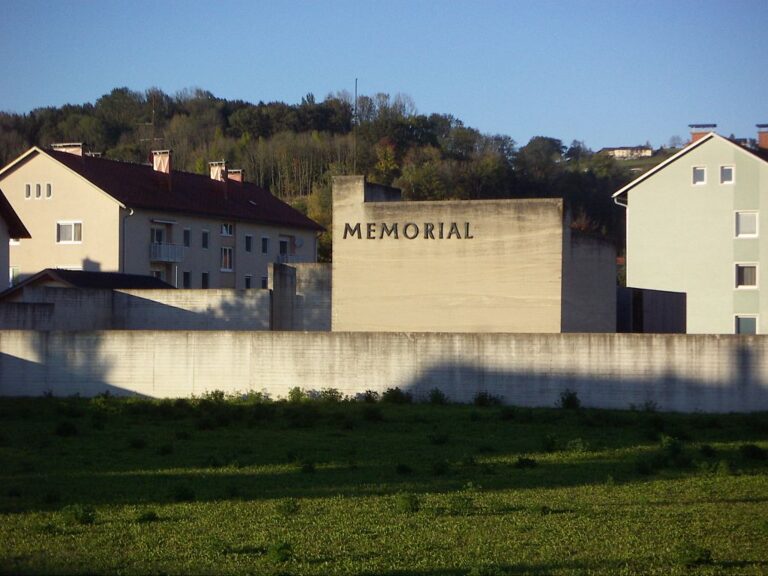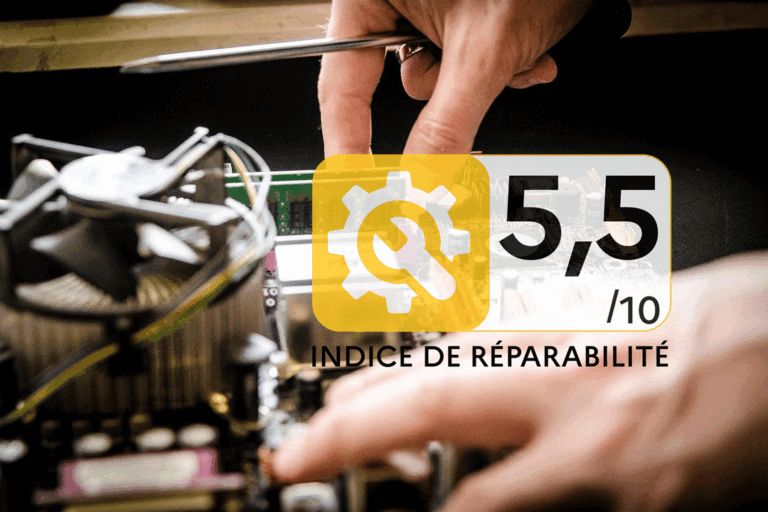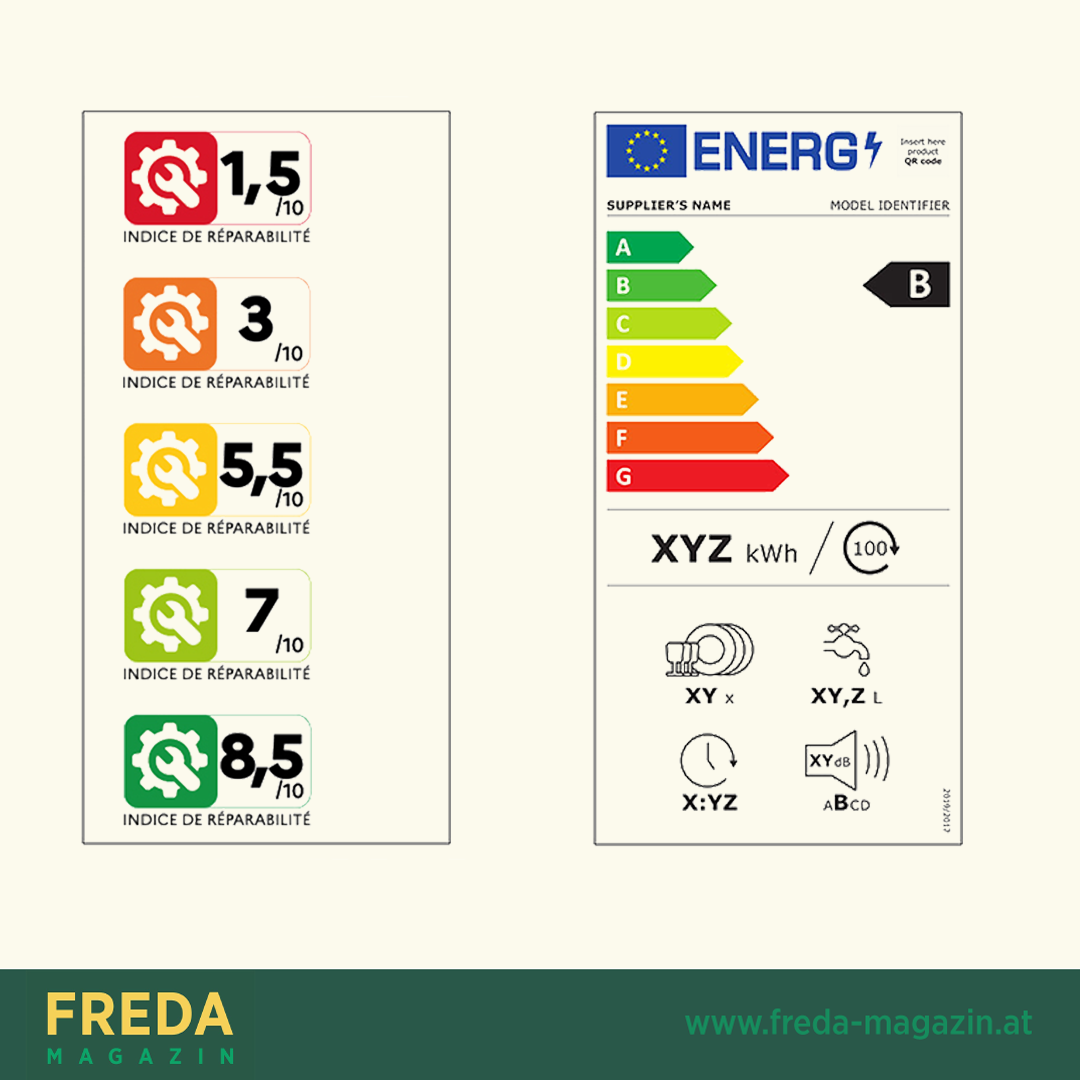Damit wir den Zug dem Flug vorziehen, muss das Verreisen auf den Gleisen attraktiv und günstiger werden. Ein wichtiger Schritt ist die Umsatzsteuerbefreiung von internationale Zugtickets ab 2023. Doch nicht nur das Ticket wird günstiger, auch das Verreisen selbst erhält ein Upgrade.
Der Sommer ist da, ab in den Urlaub: vielleicht ans Meer? Barcelona ab 86 Euro. Ein Städtetrip? London ab 41 Euro. Oder doch gleich über den Atlantik, New York ab 489 Euro. Was noch vor Jahren utopisch war, ist dank Billigairlines in den letzten Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch wo früher schnell zugegriffen wurde, klopft heutzutage immer häufiger das schlechte Gewissen an: „Ist es wirklich notwendig, mit dem Flugzeug zu verreisen?“
Klar, über den Atlantik wird es wohl kaum anders gehen, doch innerhalb Europas erreicht man viele Städte auch gut mit dem Zug. Abgesehen davon spielt natürlich der Umweltfaktor eine große Rolle. Pro Kilometer und Person werden 201 Gramm CO₂-Äquivalente ausgestoßen. Im Vergleich dazu verbraucht die Bahn nur 36 Gramm. Kein Wunder also, dass uns beim Fliegen immer häufiger die Röte der Flugscham hochsteigt.
Reisen mit Köpfchen
Flugscham, also das Empfinden von persönlicher Scham bei der Benutzung von Verkehrsflugzeugen, zeigt unser steigendes Bewusstsein für das ökologische Problem von Flugreisen – mit durchaus positiven Auswirkungen. Denn immer mehr Menschen steigen für Kurztrips auf die Bahn um. So haben 2020 über 20,6 Millionen Menschen die Züge der ÖBB für nationale und internationale Fernstrecken genutzt. Reguläre Zugfahrten sind in Österreich preislich allerdings im Vergleich zum Fliegen oder Reisen mit dem Auto noch immer ziemlich teuer. Das muss aber nicht sein.
Umsatzsteuerfrei zum Reiseziel
Ein wichtiger Schritt für einen faireren Wettbewerb zwischen Bahn und Flugzeug ist die Umsatzsteuerbefreiung von internationalen Zugtickets. Mitte Mai hat Klimaministerin Leonore Gewessler verkündet, dass internationale Tickets ab 1. Jänner 2023 von der Umsatzsteuer befreit sind. Die Ersparnis gilt für den österreichischen Streckenanteil.
Neue Nachtzüge mit mehr Komfort und Privatsphäre
Zugfahrten können schon sehr turbulent sein. Nicht wegen der Schienen, vielmehr aufgrund der Mitreisenden. Zu laut, zu viele, zu wenig Platz … kein Problem bei einer Strecke von Wien nach Linz. Anders ist das bei längeren Strecken wie eben nach Berlin oder Paris, nachts. Da wünscht man sich eine entspannte und vor allem ruhige Fahrt.
Um genau diese längeren Strecken nun attraktiver zu gestalten, hat das österreichische Zugunternehmen 20 neue Nightjets bestellt. Ab 2023 nehmen sie die Fahrt auf. Die neuen Nightjets versprechen mehr Privatsphäre und Komfort: Die siebenteiligen Nightjets bestehen aus zwei Sitzwagen, drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Sie sind in einem neuen Design ausgestattet und bieten kostenfreies WLAN (bisher nur in Railjets verfügbar) an. Zusätzlich gibt es in den neuen Liegewagen Mini Cabins für Alleinreisende. Die Mini Cabins sind mit einem Einzelbett ausgestattet. Eine Schiebetür trennt diese von den anderen Cabins und bieten so mehr Privatsphäre. Schiebetüre zu und es herrscht a Ruh‘. Auch die Schlafwagen wurden upgegradet. Künftig gibt es in den Standard- und Deluxe-Abteilen eine eigene Toilette und eine Dusche. Frisch erholt und geduscht in den Urlaub starten sozusagen. Wie das live aussehen wird, gibt es in der digitalen Vorschau von den neuen Nightjets-Abteilen zu sehen.
Wien: Europas Nightjet-Hauptstadt
Wien ist jetzt schon die Hauptstadt mit den meisten Zugverbindungen in wichtige europäische Städte wie Paris, Brüssel und Rom. Möglich ist das durch die gemeinsame Nachtzug-Offensive der ÖBB mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF, der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und mit den Niederländischen Eisenbahnen (NS). Seit 2021 hat man von Wien aus Europas Schienen Stück für Stück ausgebaut. Ein romantischer Ausflug in die Stadt der Liebe ist so dreimal die Woche möglich und preislich auch wirklich okay: Liegewagen ab 59,90 Euro oder Schlafwagen ab 89,90 Euro. Abzüglich der Umsatzsteuer im kommenden Jahr wäre das doch ein perfektes Geschenk für einen leistbaren Valentinstag-Ausflug. Wie du auch während deines Urlaubs auf die Umwelt schauen kannst, haben wir in einem kleinen Tutorial zusammengestellt: Nachhaltigkeit im Trolley.